Oberlidretraktion bei endokriner Orbitopathie
Die Oberlidretraktion ist das häufigste
Symptom bei endokriner Orbitopathie (5.1). Ursache ist ein autoimmuner
Entzündungsprozess der Orbita.
Die primäre Retraktion entsteht durch eine Überaktivität des Levator palpebrae
oder des Müllerschen Muskels, begünstigt durch Entzündung oder Fibrose.
Kortikosteroide können in der aktiven Phase die Entzündungsaktivität
reduzieren, verhindern jedoch nicht zuverlässig das Auftreten einer Retraktion
und können eine bereits bestehende Fibrose nicht rückgängig machen.
Eine Fibrose des Musculus rectus inferior kann eine sekundäre Retraktion des
Oberlids durch einen Kompensationsmechanismus verursachen.
Bei ausgeprägtem Exophthalmus kann eine Pseudoretraktion auftreten, da der nach
vorne verlagerte Bulbus das Oberlid in eine höhere Position zwingt.
Die drei Formen der Retraktion erfordern unterschiedliche operative Verfahren:
- Primäre Retraktion: Operation zur Schwächung des Levators oder des
Müllerschen Muskels
- Sekundäre Retraktion: Rezession des Musculus rectus inferior
- Pseudoretraktion: Orbitadekompression
Primäre Oberlidretraktion bei endokriner Orbitopathie
Die primäre Oberlidretraktion beruht auf
einer Entzündung oder Fibrose der Retraktoren, was zu einem Elastizitätsverlust
führt und eine höhere Position des Oberlids verursacht. Die vordere Lamelle ist
intakt, während die hintere Lamelle mit dem Lidheber und dem Müllerschen Muskel
einen Elastizitätsverlust oder sogar eine Retraktion zeigt.

Abb. 1: Ausgeprägte primäre Retraktion
beider Oberlider bei mäßigem Exophthalmus.

Abb. 2: Postoperativ nach Schwächung des
Lidhebermuskels und des Müllerschen Muskels. Normale Lidposition, aber hoher
Lidfurchenstand.

Abb.
3: Mäßige primäre Retraktion des rechten Oberlids

Abb. 4: Postoperativ nach Schwächung des
Lidhebermuskels in hoher Höhe nahe des Whitnall-Ligaments. Mit dieser Technik
weniger Anhebung der Lidfurche.
Chirurgische Technik bei primärer Oberlidretraktion
Der Zugang erfolgt transkutan wie bei der
Ptosis-Operation. Nach Eröffnung des Orbitaseptums wird der Lidhebermuskel
dargestellt. Erfolgt die Durchtrennung in höherer Höhe nahe des
Whitnall-Ligaments, genügt ein kurzer Schnitt (Abb. 5). Zur Bestimmung des
Inzisionsniveaus kann eine Spatel im oberen Fornix eingeführt werden;
geschnitten wird dort, wo die Spatel endet (Abb. 7, 8). Bei ausgeprägter
Fibrose muss der Schnitt beidseits erweitert werden, um die seitlichen Fasern
zu durchtrennen, die mit dem Tarsus verbunden bleiben (Abb. 6).

Abb. 5: Lange rote Linie zeigt die
Durchtrennung der Aponeurose in niedriger Höhe. Wird die Durchtrennung in
höherer Höhe nahe des Whitnall-Ligaments durchgeführt, genügt ein kürzerer
Schnitt.
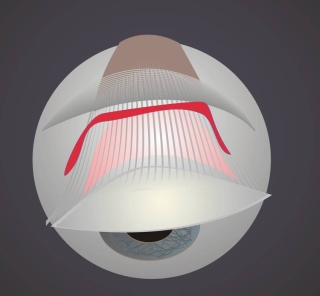
Abb. 6: Bei ausgeprägter Fibrose muss der
Schnitt hoch beidseits erweitert werden, um die seitlichen Fasern zu
durchtrennen, die mit dem Tarsus verbunden sind.
Sekundäre Oberlidretraktion bei endokriner Orbitopathie
Die sekundäre Oberlidretraktion beruht auf
einer Entzündung oder Fibrose des unteren Geradermuskels. Dies führt zu
Elastizitätsverlust und Restriktion, sodass die Aufwärts- und Geradeausbewegung
des Auges erschwert ist. Als Folge entsteht ein Kompensationsmechanismus mit
Hyperaktivität des oberen Geradermuskels zusammen mit dem Lidheber. Das
Ergebnis ist eine übermäßige Höhe der Oberlider (Abb. 9).
Diagnose: Verschwindet die sekundäre
Retraktion, wenn der Patient nach unten schaut (Abb. 10), kann die Diagnose
gestellt werden.

Abb. 9: Sekundäre Retraktion durch Fibrose
der unteren Geradermuskeln. Kompensation durch Hyperaktivität des oberen
Geradermuskels zusammen mit dem Lidheber. Führt zu übermäßiger Höhe der
Oberlider.

Abb. 10: Diagnose der sekundären
Retraktion: verschwindet, wenn der Patient nach unten blickt.
Pseudoretraktion des Oberlids durch Exophthalmus
In manchen Fällen kann der Exophthalmus
(Proptosis) eine höhere Oberlidposition verursachen, da das Auge nach vorne
verlagert ist und das Oberlid zurückbleibt. Dies wird mit Hertel-Messungen
evaluiert. Dieses Phänomen wird als Pseudoretraktion definiert.
Ist das Auge nach vorne verlagert (Exophthalmus), steigt der Oberlidrand höher
als das Hornhaut-Limbusniveau (Abb. 11, 12). Die Pseudoretraktion wird durch
zwei Faktoren verursacht: erstens durch den Exophthalmus, zweitens durch die
Position des M. orbicularis entlang des Bulbusäquators.
Die Position des Lidrandes im offenen Zustand ähnelt einer Hyperbel, deren
Bogen länger ist als die Lidrandlänge im geschlossenen Zustand. Dadurch trägt
die Spannung des M. orbicularis zur Retraktion bei.

Abb. 11: Normalerweise liegt die Achse zwischen
den Lidwinkeln (grauer Punkt) vor der horizontalen Achse des Bulbus. Der
Oberlidrand verläuft in einer hyperbolischen Kurve, deren Länge größer ist als
die Lidrandlänge im geschlossenen Zustand.

Abb. 12: Bei Exophthalmus kann die Achse
zwischen den Lidwinkeln (grüner Punkt) hinter der horizontalen Achse des Bulbus
liegen. Der Oberlidrand im offenen Zustand hat dieselbe oder sogar kürzere
Länge als im geschlossenen Zustand. Der M. orbicularis hat dadurch keine
Effektivität mehr beim Schließen und verstärkt die Retraktion.
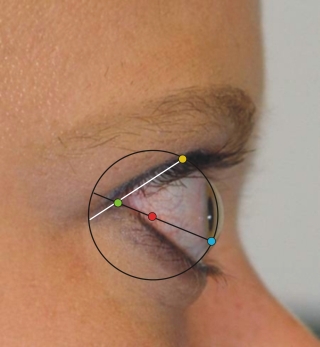
Abb. 13: Bei Exophthalmus liegt die Achse
zwischen den Lidwinkeln (grüner Punkt) sogar hinter der horizontalen Achse des
Auges (roter Punkt). Radius und Lidrandlänge im offenen Zustand (blauer Punkt)
sind gleich oder kürzer als im geschlossenen Zustand. Der M. orbicularis kann
nicht mehr effektiv schließen und verstärkt die Retraktion. Chirurgische
Korrektur sollte eine Orbitadekompression beinhalten.